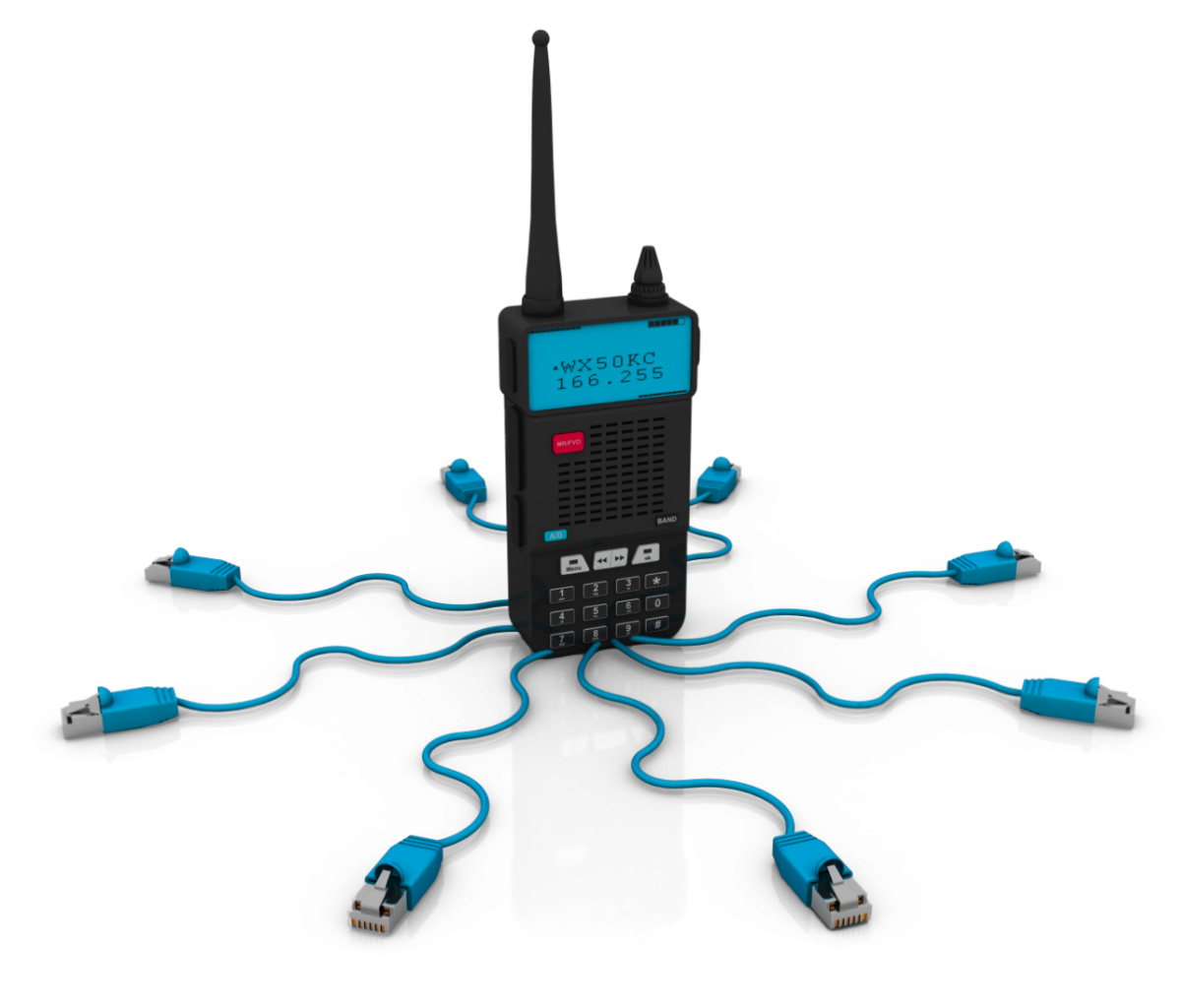Gerade in gewachsenen Systemen lauern Altlasten, die dein Projektbudget sprengen, Timings torpedieren oder sogar die technische Machbarkeit infrage stellen können. Wer hier zu spät hinschaut, zahlt später drauf: mit Frust, Overhead oder im schlimmsten Fall sogar mit einem gefährdeten Ruf.
Deshalb gilt: Je früher du Klarheit über den Ist-Zustand gewinnst, desto besser kannst du liefern.
Tech-Evaluation: Den Stack kritisch prüfen, bevor du zusagst
Nicht jeder Tech-Stack ist per se schlecht, aber nicht jeder passt zur Problemstellung. Achte bei der Evaluierung besonders auf:
Skalierbarkeit: Ist der Stack in der Lage, mit dem geplanten Wachstum mitzuhalten? Oder stößt er bei Lastspitzen an Grenzen?
Aktualität: Wird das Framework noch aktiv gepflegt? Gibt es Security-Patches und eine Community?
Team-Fit: Hat das interne Team Erfahrung mit der eingesetzten Technologie oder bist du allein damit?
Frage am besten konkret nach, warum bestimmte Technologien im Projekt genutzt werden. „Historisch gewachsen“ ist kein valides Architektur-Argument.
Wartbarkeit, Dokumentation und Support: Die unterschätzten Indikatoren
Die wahre Qualität eines Projekts zeigt sich selten auf den ersten Blick. Achte daher auf:
- Dokumentation: Ist sie vorhanden? Verlässlich? Aktuell?
- Tooling: Gibt es CI/CD-Prozesse? Tests? Monitoring?
- Supportmöglichkeiten: Wie schnell kannst du Fehler identifizieren und beheben? Gibt es Logging-Standards, eine saubere Fehlerbehandlung?
Fehlt es hier, bist du schnell nicht mehr Entwickler:in, sondern Archäolog:in.
Gespräche mit dem Team: So erkennst du verborgene Problemzonen
Technische Schulden sind oft ein Symptom, keine Ursache. Die wahren Gründe erfährst du nur im direkten Austausch:
- Stell gezielte Fragen: Welche Teile des Systems bereiten euch Bauchschmerzen? Gibt es Module, die niemand mehr anfasst?
- Beobachte nonverbale Hinweise: Zögern, Ausweichverhalten, Witze à la „Da fasst keiner mehr ran“ … alles wertvolle Indikatoren!
Die Erfahrung zeigt: Je offener das Team über Schwächen spricht, desto eher kannst du realistisch planen.
Code Audits: So analysierst du bestehende Codebasen
Ein strukturiertes Audit bringt Klarheit, auch wenn der Code chaotisch ist:
1. Bestandsaufnahme: Welche Komponenten gibt es? Welche sind kritisch?
2. Analyse auf mehreren Ebenen: Architektur, Codequalität, Testabdeckung, Sicherheitsaspekte
3. Risikobewertung: Was muss dringend überarbeitet werden? Was ist „technische Schuld mit Zinsaufschlag“?
Wichtig: Bleibe objektiv. Keine Schuldzuweisungen, sondern konstruktive Vorschläge.
Findings priorisieren und kommunizieren
Nicht alles muss sofort repariert werden, aber alles muss benannt werden.
Priorisiere nach Risiko und Aufwand: Was gefährdet das Projektziel? Was kann später behoben werden?
Klar kommunizieren: Visualisiere deine Erkenntnisse, nenne konkrete Vorschläge und sei transparent, wo Unsicherheiten bestehen.
Ein gut strukturierter Audit-Bericht ist nicht nur ein technisches Dokument, sondern oft auch dein stärkstes Argument für Vertrauen.
Reverse Engineering in der Praxis: Wenn Dokumentation fehlt
Willkommen in der Realität: Viele Projekte starten mit unvollständiger oder gar vollständig fehlender Dokumentation. Was für Teams im Tagesgeschäft oft ein verdrängtes Problem ist, wird für dich als externe:r Freelancer schnell zur Herausforderung. Denn ohne belastbare Informationen zur Systemarchitektur, zu Schnittstellen oder Abhängigkeiten wird aus dem Projektstart eine Detektivarbeit.
Doch mit der richtigen Herangehensweise kannst du selbst in solchen Situationen schnell Struktur schaffen.
1. Visuelle Modelle erstellen
Bevor du tiefer in den Code steigst, hilft dir ein visuelles Verständnis des Systems, um Zusammenhänge schneller zu erfassen. Skizziere die Architektur auf hoher Ebene:
- Wie fließen Daten durch das System?
- Welche Module kommunizieren miteinander?
- Wo gibt es Schnittstellen zu externen Services?
Nutze dafür Tools wie draw.io, Lucidchart, das C4 Model oder klassische UML-Diagramme. Gerade für Stakeholder oder fachfremde Entscheider:innen sind solche Visualisierungen oft der erste Schritt, um technische Komplexität nachvollziehbar zu machen. Gleichzeitig legst du damit die Basis für spätere Optimierungen und saubere Kommunikation.
2. Mapping-Methoden anwenden
Um ein über Jahre hinweg gewachsenes System zu durchdringen, ist es hilfreich, bestehende Abhängigkeiten und Strukturen aktiv zu kartieren:
- Erstelle Dependency Maps, um zu erkennen, welche Module wie stark miteinander verflochten sind.
- Verwende Sequence Diagrams, um typische Abläufe (z.B. beim Login oder bei Datenverarbeitung) nachzuvollziehen.
- Analysiere Event-Flows und Messaging-Strukturen, besonders bei Microservices- oder Event-Driven-Architekturen.
So entwickelst du ein funktionales Verständnis der Applikation, unabhängig davon, ob jemand das System jemals dokumentiert hat.
3. Wissen gezielt aus dem Team extrahieren
Auch wenn keine formale Dokumentation existiert: Das Wissen über das System ist in der Regel vorhanden. Es ist nur nicht schriftlich, sondern verteilt in den Köpfen verschiedener Teammitglieder. Um dieses Wissen verfügbar zu machen, brauchst du eine strukturierte, kommunikative Herangehensweise:
- Führe gezielte Gespräche mit Entwicklerinnen, Product Ownern, QA oder DevOps.
- Stelle konkrete Fragen wie z.B.: „Welcher Teil des Codes ist am wenigsten stabil?“ „Welche Komponente verursacht die meisten Bugs?“ „Wo treten im Betrieb wiederkehrende Probleme auf?“
- Dokumentiere deine Erkenntnisse konsequent, idealerweise direkt in einer zentralen, gemeinsamen Wissensbasis.
Besonders hilfreich ist es, wenn du mit sogenannten „System Walkthroughs“ arbeitest: Lass dir von Teammitgliedern bestimmte Use Cases oder Workflows live im Code erklären. So entsteht ein gemeinsames Verständnis und du sammelst dabei wertvolle Informationen für dein eigenes Onboarding.
4. Technische Intuition entwickeln
Intuition und Technik scheinen zwei sehr gegensätzliche Begriffe zu sein, aber nicht zuletzt ist Reverse Engineering auch eine Frage der Erfahrung. Je mehr gewachsene Systeme du gesehen hast, desto schneller erkennst du typische Muster, Red Flags und implizite Logiken. Achte auf Dinge wie:
- ungewöhnlich komplexe Methoden oder Klassen
- duplizierten Code
- veraltete Bibliotheken oder schwer nachvollziehbare Konfigurationen
Diese Hinweise zeigen dir schon früh, wo du mit erhöhtem Aufwand oder potentiellen Fallstricken rechnen musst.
Warum eine solide Analyse vor dem Start dein wichtigstes Verkaufsargument ist
Die Zeit vor Projektbeginn ist deine Chance, Vertrauen aufzubauen, Risiken realistisch einzuschätzen und die Weichen für Erfolg zu stellen.
Ein strukturierter, methodischer Blick auf den Ist-Zustand macht dich nicht nur zum/zur Problemlöser:in, sondern zum strategischen Asset.
Drei Fragen, die du immer stellen solltest, bevor du ein Projekt annimmst
- Wie sieht die bestehende Architektur aus und wo liegen bekannte Schwachstellen?
- Gibt es aktuelle Dokumentation oder Onboarding-Materialien?
- Wer kann mir am meisten über das System erzählen und wie offen ist der Austausch?
Du weißt, was du kannst und bist auf der Suche nach einem neuen Projekt? Dann melde dich bei Maria!